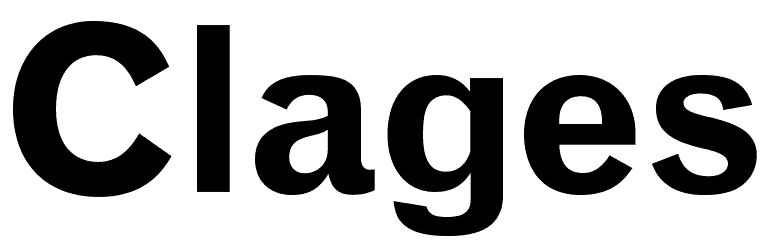Claus Richter | Easy
- Nov. 2021 – Jan. 2022
„Wahrlich, es würde euch Angst und Bange werden, wenn die ganze Welt, wie ihr es fordert, einmal im Ernst durchaus verständlich würde“ schrieb Friedrich Schlegel um 1800.[1]Seit der deutschen Romantik wird das Unverständliche, Fragmentarische und Widersprüchliche, das sich systematischen Festlegungen verweigernde, als ästhetisches Paradigma in der Kunst gewürdigt.
Für die Einzelausstellung „Easy“, in der Kölner Galerie Clagesentwirft Claus Richter eine ganze Erlebniswelt voller non-binärer, ambivalenter und uneindeutiger Momente.„Easy“ versteht sich als die manische Gegenausstellung zu „Nothing Is Easy“, die 2010 im Leopold Hoesch Museum Düren unter dem Leitmotiv der Sehnsucht stattfand. Doch während in Düren ein grüner Schleim des Neids an den Wänden klebte, herrscht in Köln eine heiter aufgekratzte, vorweihnachtliche Anspannung.
Gleich am Eingang werden Benjamin’sche Schaufensterflaneur*innen von einer rasenden Kutsche zu einem eskapistischen Parcours eingeladen, die eigene innere Leere durch obsessiven Konsum zu stillen. Eine mild gefärbte, bukolische Naturlandschaft, ein Brueghel’scher Jahreszeitenzyklus, der die Naturtheorie Ralph Waldo Emersons zitiert, führt bald in den Nukleus der Galerie. Hier liegt der Schlüssel zu der Ausstellung in Gestalt einer Cornflakes Packung vor. Wie in einem Werbesport löst das Aufreißen der Packung einen Vulkanausbruch an Referenzen aus. Pinke Feen entwischen wie Disneys Tinkerbell in die Räumlichkeiten der Galerie und führen die Besucher*innen in die Herstellungsprozesse und Handelswege der Frühstücksflocken ein. Hier hängen die Einkaufstüten aus den Boutiquen der Shopping-Mall, in denen die Cornflakes nachhause transportiert werden. Dort drehen sich die Flügel einer Windmühle bei Tag und bei Nacht. Dies vollzieht sie fast schon meditativ, ähnlich einer Headspace-Soundscape; das heißt Entspannt bleiben, um dran zu bleiben; Arbeiten bis zum Umfallen. In einem angeberischen Tonfall flüstern die Elfen den Besucher*innen von den zahllosen abgeleisteten Überstunden in der Getreidemühle zu. Schließlich gilt es die kleinen Zuckerflocken am laufenden Band zu produzieren.
Bei kurzem Nachdenken erscheint aufmerksamen Besucher*innen das symbolträchtige Getreidekorn doch etwas zweckentfremdet, galt es noch zu Schlegels Zeiten, den Hunger durch einen einfachen Brotlaib zu stillen. So eine schlichte Kapitalismuskritik kümmert die überarbeiteten Fantasiegestalten freilich wenig. Sie weisen die Besucher*innen die Galeriegänge hoch und an vielen unterschiedlichen Bildmotiven vorbei. Am Schluss der bruchstückhaften Erzählung Richters tritt das monokulturelle Korn wieder motiviert in Erscheinung, um den Besucher*innen im Ziel zu gratulieren. „Daumen hoch, Ihr habt es geschafft!“.
Fragt sich bloß, was eigentlich erreicht wurde?
Die alltägliche Frage von Schaffen und Nicht-Schaffen, von Anerkennung, Scheitern und Misserfolg in einer überkapitalisierten Gegenwart, wird auch in der Gestaltung der einzelnen Werke Richters sichtbar. Sie sind keine industriell hergestellten Readymades, sondern von Hand gefertigt, bunt und nicht ganz perfekt. Ähnlich wie die Besucher*innen streben sie danach in einer ganz und gar kommerzialisierten und medialisierten Welt ‚mithalten’ zu können und nicht in einer Menge von Unbrauchbarem unterzugehen.[2]Dafür werden auch Anleitungen für eine verzweifelte Selbstoptimierung studiert, die sich in Selbsthilfebüchern, Meditationsapps und von einer fiesen „toxic positivity“ Einstellung ganz einfach „erlernen“ lässt. DIY in allen Lebenslagen. „Easy“ hüllt sich ein in eine wimmelnde, nervöse Ästhetik, die von frickeligen Basteleien, winzigen Figürchen oder von einer schnellen Befriedigung in Form überdimensionaler Niedlichkeit gesättigt ist. Bewusst blüht hier ein Kosmos aus linker Ökopädagogik (Verbieten verboten!), Sesamstraße, und hyperwestlicher Amerikanisierung auf, den Richter seit seiner Kindheit verinnerlicht hat.
„Easy“ begreift sich als selbstreferentieller Vergnügungspark, der durch sein Spiel mit der Ambiguität einen assoziativen Überschuss an Bedeutung generiert. Zugleich wirddas nostalgische Versprechen Peter Pans, niemals wirklich erwachsen werden zu müssen, in seiner Erscheinung sehnsuchtsvoll aufrechterhalten, gleichwohl die unmögliche Erfüllung dessen – wie das weihnachtliche Ritual, das nur aus Gründen der Erwartungshaltung vollzogen wird – allen Erwachsenen längst bewusst geworden ist. Die Kunst Richters kann daher auch als eine Form der Widerständigkeit, als das trotzige Aufrechterhalten einer kindlichen Fassade verstanden werden, indem sie mitunter auch ironische Züge annimmt. Für Schlegel ist die Ironie eine effektive Form der Unverständlichkeit, eine zum Nachdenken anregende Strategie, die sich bei Richter jedoch nicht von der Pose eines unproduktiv zynischen Kulturpessimismus vereinnahmen lässt. In Richters zutiefst liebevoller und aller Widrigkeiten zum Trotz optimistischen Welt gibt es keine moralischen Erhebungen, keine Aus- und Abgrenzung und schon gar keine straighte Coolness, die sich über die eigenen Unsicherheiten stülpen will. Sie ist tiefgründig und gleichzeitig banal, sie ist romantisch und zugleich hyperreal. Sie übt einen flexiblen Spagat zwischen Affirmation und Kritik.
Florentine Muhry
[1]FriedrichSchlegel, „Über die Unverständlichkeit [1800]“, in: ders., Politische und Ästhetische Schriften. Versuch über den Begriff des Republikanischen, Über das Studium der griechischen Poesie, Über Lessing, ebook 2018.
[2]Tom Holert und Mark Terkessidis, „Einführung in den Mainstream der Minderheiten [1996|“, in: Texte zur Theorie des Pop, hrsg. von Charis Goer, Stefan Geif und Christoph Jacke, Stuttgart 2013.